Ist sie gesund, nehmen wir sie kaum wahr. Macht die Blase aber Probleme, kann das die Lebensqualität erheblich mindern. Man kann einiges tun, um die Blasengesundheit zu unterstützen.
Die Blase hält sich diskret im Hintergrund. Vier- bis siebenmal täglich meldet sie sich im Schnitt – immer dann, wenn sie geleert werden möchte. Als muskulöses Hohlorgan sammelt sie den von den Nieren gefilterten Urin. Sie fasst rund 500 Milliliter und dehnt sich flexibel aus, bis Sensoren in der Blasenwand ein klares Signal senden: Zeit für einen Toilettengang. Dabei sorgen Schliessmuskeln und der Beckenboden dafür, dass der Urin kontrolliert ausgeschieden wird.
Frauen sind anfälliger
Die Harnblase liegt geschützt im Becken hinter dem Schambein und wird vom Beckenboden stabilisiert. Die Harnröhre von Frauen ist mit 3 bis 5 Zentimetern deutlich kürzer als die der Männer mit rund 20 Zentimetern. Kommt hinzu: Frauen haben eine schwächere Beckenbodenmuskulatur, zudem gibt es im weiblichen Beckenboden drei Öffnungen (Harnröhre, Vagina und Enddarm).
Diese anatomischen Unterschiede machen Frauen anfälliger für Blasenprobleme, vor allem in den Wechseljahren. Denn durch den Hormonabfall nehmen die stützenden Muskeln und die Blasenelastizität ab. Zudem werden die vaginalen Schleimhäute und Harnwege trockener, was Infektionen begünstigt. Bei Männern treten Blasenprobleme hingegen mit zunehmendem Alter häufig aufgrund von Prostatabeschwerden auf.
Achtung, Blasenentzündung
Etwa jede zweite oder dritte Frau leidet einmal in ihrem Leben an einer Blasenentzündung. Die kurze Harnröhre sowie die Nähe von Harnröhrenöffnung und Darmausgang erleichtern es Keimen, in die Blase zu gelangen. Dann kommt es zum «Feueralarm» in der Blase – dem brennenden Schmerz beim Wasserlassen. Weitere typische Symptome sind starker Harndrang, obwohl nur wenig Urin entleert wird, Brennen oder Schmerzen beim Urinieren, Schmerzen und Krämpfe im Unterbauch sowie unangenehm riechender, trüber Urin. Zur Behandlung der Entzündung im Anfangsstadium hilft es, die Trinkmenge zu erhöhen, um die Blase gut zu spülen. Dazu eignen sich besonders spezielle Nieren- und Blasentees sowie Produkte mit Liebstöckelwurzel oder Bärentraubenblätterextrakt, die eine harntreibende Wirkung und antibakterielle Eigenschaften aufweisen. Bei Verdacht auf eine Blasenentzündung kann die Apothekerin oder der Apotheker bei einem vertieften, kostenpflichtigen Beratungsgespräch (ggf. mit Urintest) feststellen, ob es sich um eine Blasenentzündung handelt und ob sowie mit welchen Medikamenten diese behandelt werden kann. Bei schweren Fällen ist eine Weiterleitung an eine Ärztin oder einen Arzt unabdingbar.
- Genügend trinken: 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit täglich halten die Blase in Schwung und spülen Keime aus. Zurückhaltung ist bei Kaffee und Alkohol sowie bei kalten und kohlensäurehaltigen Getränken angezeigt. Diese können die Blase reizen.
- Warm halten: Nasse Kleidung gleich wechseln und auf eine bauchfreie Kleidung verzichten, um eine Auskühlung des Beckenbereichs zu vermeiden.
- Hygiene beachten: Frauen sollten nach dem Toilettengang stets von vorne nach hinten wischen, um das Risiko für Keimübertragungen zu minimieren.
- Wasserlassen nach dem Geschlechtsverkehr: Dies hilft, Keime aus der Harnröhre zu spülen.
- Blasenfreundliche Ernährung: Den Verzehr von scharfen Gewürzen, Zucker, Süssstoffen und Zitrusfrüchten mit hohem Säuregehalt reduzieren, denn diese können die Blase reizen.
- Entspannungstechniken: Stress gilt als möglicher Auslöser einer Reizblase, regelmässige Entspannung wirkt dem entgegen.
- Aufrechtes Sitzen und leichter Sport: Dies kann die Rumpf- und Beckenboden- muskulatur unterstützen. Intensiver Sport mit Schlägen hingegen kann den Druck auf die Blase und die Muskulatur erhöhen.
Die Scham mit der Inkontinenz
Ein weiteres, sensibles Blasenproblem ist ungewollter Urinverlust, umgangssprachlich Blasenschwäche genannt. Inkontinenz tritt auf, wenn Blasenmuskulatur, Schliessmuskeln und Beckenboden nicht mehr richtig zusammenspielen. Frauen leiden aufgrund einer Geburt oder hormoneller Veränderungen öfter daran. Manche kennen das: Allein ein Lachen, Husten oder Niesen genügt, und es tröpfelt ungewollt. Diese häufige Form der Blasenschwäche nennt man Belastungsinkontinenz: Der Schliessmuskel versagt unter Druck bei körperlicher Belastung. Ursachen können ein schwacher Beckenboden, Harnwegsinfekte oder neurologische Erkrankungen wie etwa Parkinson, Migräne, Multiple Sklerose und mehr sein. Eine andere Form ist die Dranginkontinenz. Hier tritt plötzlich starker und kaum kontrollierbarer Harndrang auf. Es gibt auch eine Mischform von Belastungs- und Dranginkontinenz.
Ursachen der Reizblase unklar
Ein plötzlich auftretender Harndrang – mit oder ohne Inkontinenz – zeigt sich auch bei einer überaktiven Blase, der sogenannten Reizblase. Betroffene müssen öfter Wasserlassen, ohne dass ihre Blase voll ist. Sie haben das Gefühl, immer in der Nähe einer Toilette sein zu müssen. Die Ursachen für den Drang sind unklar, sie können hormonell, psychisch oder stressbedingt sein. Behandlungsmöglichkeiten reichen von Blasen- und Beckenbodentraining über Medikamente und Pessare (medizinisches Hilfsmittel, das in die Vagina eingeführt wird) bis hin zu hormonellen Therapien. In schweren Fällen kann auch eine Operation eine Option sein. Massnahmen wie regelmässiges Toilettentraining, ausreichend trinken und Entspannungstechniken können vorbeugend wirken.
Blasenprobleme können die Lebensqualität deutlich einschränken. Daher ist es wichtig, den Arztbesuch nicht aus Scham hinauszuzögern. Wer überdurchschnittlich oft Wasser lassen muss, plötzlichen Harndrang oder schon bei wenig Bewegung Inkontinenz verspürt, sollte sich Hilfe suchen.
Übungen zur Stärkung des Beckenbodens
- Die «Brücke»: Auf dem Rücken liegen, die Beine angewinkelt, und das Becken heben – allenfalls Ball oder Kissen zwischen die Knie klemmen.
- Beckenboden anspannen, als ob der Harnfluss gestoppt würde, und wieder loslassen. Diese Übung lässt sich überall machen – egal, ob im Sitzen, Stehen oder Liegen.
- Zusätzlich kann Blasentraining helfen, den Harndrang besser zu kontrollieren, indem Toilettengänge schrittweise hinausgezögert werden.
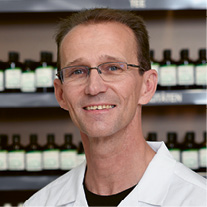
Christian Hehl
Drogist, Apotheker und Geschäftsinhaber
Wie bewerten Sie die vorbeugende Wirkung von Preiselbeeren und D-Mannose bei Harnwegsinfektionen?
Bei unkomplizierten, wiederkehrenden Harnwegsproblemen kann ich Preiselbeere und D-Mannose empfehlen. Preiselbeeren haben einen etwas höheren Gehalt an Proanthocyanidinen als Cranberrys. Diese Gerb- und Bitterstoffe machen die Blasenwand glatter, sodass Bakterien nicht gut andocken können. Präparate mit D-Mannose – das ist ein Zucker, der Bakterien an sich bindet – haben denselben Effekt. Wichtig ist auch, genügend zu trinken. Wenn man zu wenig trinkt, wird der Harn konzentrierter und die Harnröhre schlechter durchspült, so können sich Keime leichter vermehren.
Mit welchen natürlichen Mitteln lässt sich eine Blasenentzündung behandeln?
Wir setzen auf Phytotherapie. Die Therapie erster Wahl bei einer Blasenentzündung im Anfangsstadium – solange kein Blut im Urin ist, kein Fieber und keine Lendenschmerzen auftreten – ist eine Durchspülungstherapie. Pflanzliche Mittel enthalten zum Beispiel die nierenanregende Brennnessel, Indischen Nierentee (Katzenbart), entzündungshemmende Goldrute und die Bärentraube. Diese Heilpflanze für den Harntrakt weist antibakterielle Eigenschaften auf und fördert im Gegensatz zu Antibiotika keine Resistenzen.
Hilft Phytotherapie auch bei Blasenschwäche?
Bei der Inkontinenz empfehle ich regelmässiges Beckenbodentraining sowie eine Tinktur mit Sägepalme, welche die Blasenmuskulatur stärkt.


